Wenn Sie unter Schmerzen beim Zubeißen, Beschwerden beim Gähnen oder einem Knacken beim Öffnen und Schließen Ihres Mundes leiden, kann die Magnetresonanztomographie des Kiefers, auch als MRT Kiefer bekannt, die richtige Lösung bieten.
Diese modernste Untersuchungsmethode ermöglicht eine detaillierte und präzise Diagnose von Erkrankungen und Störungen im Kieferbereich. Oft verlaufen solche Beschwerden lange Zeit schmerzfrei und werden erst spät erkannt.
Mit der MRT Kiefer können frühzeitig mögliche Ursachen identifiziert werden, was eine gezielte und effektive Behandlung ermöglicht. Unsere erfahrenen Fachleute stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Gesundheit und Lebensqualität zu verbessern. Wenden Sie sich an uns, um herauszufinden, wie die MRT Kiefer Ihnen bei Ihren Beschwerden helfen kann.
Untersuchung des Kiefergelenks mittels MRT Kiefer
All das können Hinweise auf eine Erkrankung des Kiefergelenks sein, eine sogenannte craniomandibuläre Dysfunktion (CMD). Etwa 15 Prozent der erwachsenen Deutschen leiden unter behandlungsbedürftigen CMD-Beschwerden, doch diese werden oftmals erst spät erkannt.
Die MRT Kiefer Magnetresonanztomographie (MRT) kann auf dem Weg zur korrekten Diagnose einen wichtigen Beitrag leisten. Im Folgenden erfahren Sie alles über dieses Verfahren.
Das Kiefergelenk – mechanisch ausgeklügelt
Das Kiefergelenk stellt die Verbindung zwischen dem Schläfenbein, dem Os temporale, und dem Unterkiefer, der Mandibula, her. Dabei bildet die sogenannte Fossa mandibularis des Schläfenbeins die Gelenkpfanne und das Caput mandibulae, ein Gelenkfortsatz des Unterkiefers, den Gelenkkopf. Der Krümmungsradius des Caput mandibulae ist deutlich kleiner als der der Fossa mandibularis, weshalb die beide Gelenkanteile über einen aus Faserknorpel und straffem, parallelfasrigen Bindegewebe aufgebauten Gelenkkörper, einen sogenannten Discus articularis, miteinander verbunden sind.
Umgeben ist das Gelenk von einer Kapsel, die sehr weit ist und aus vielen elastischen Fasern besteht. An den Seiten wird sie durch Bindegewebszüge, ein Ligamentum mediale und ein Ligamentum laterale, verstärkt. Darüber hinaus wird das Kiefergelenk durch weitere Bänder stabilisiert: Das Ligamentum stylomandibulare, das Ligamentum sphenomandibulare und die Raphe pterygomandibularis liegen außerhalb der Gelenkkapsel.
Das Kiefergelenk ermöglicht sowohl das Öffnen und Schließen des Mundes, als auch ein Vor- und Zurückschieben des Unterkiefers sowie seitliche Mahlbewegungen nach außen und nach innen. Das Kauen ist immer ein zusammengesetzter Prozess aus diesen Bewegungsformen.
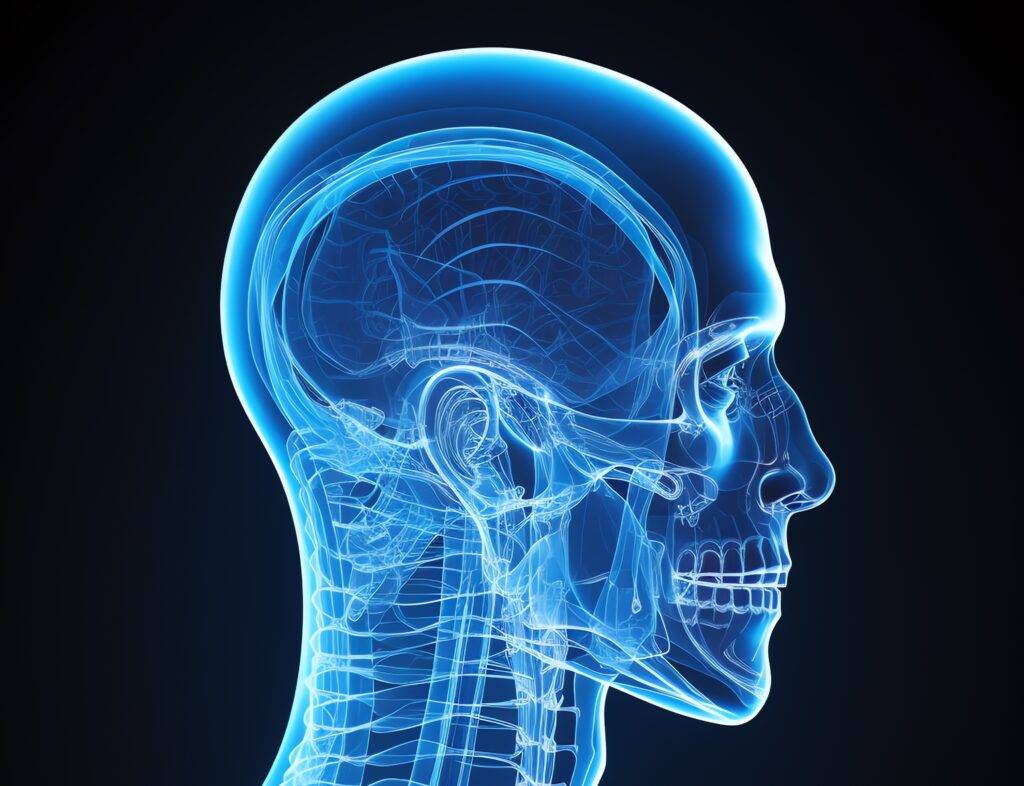
Craniomandibuläre Dysfunktion erkennen: Die Rolle des MRT Kiefer
Unter den Begriff der craniomandibulären Dysfunktion fallen verschiedene Erkrankungen der Kiefergelenke und Kaumuskeln sowie Störungen der Zahnkontakte. Meist machen sich diese durch Schmerzen und Bewegungseinschränkungen im Kopf-Hals-Bereich bemerkbar – beim Kauen aber auch in Ruhe. Gleichzeitig haben Betroffene häufig Probleme, den Mund weit zu öffnen, in anderen Fällen kann es aber auch zu einer Überbeweglichkeit der Kiefergelenke kommen. Zusätzlich kann beim Kauen oder Sprechen ein Knacken und Reiben im Kiefergelenk auftreten. Bei solchen Symptomen ist eine MRT Kiefer-Untersuchung oft unerlässlich, um eine genaue Diagnose zu stellen.
Viele CMD-Patienten knirschen mit den Zähnen, was auch als Bruxismus bezeichnet wird, was umgekehrt aber auch das Risiko für eine CMD erhöht. Durch die ständige Muskelanspannung beim nächtlichen Zähneknirschen können Schmerzen oder morgendliche Steifigkeit in den Kaumuskeln oder in angrenzenden Muskelgruppen hervorgerufen werden. Die Aufnahme von MRT Kiefer-Bildern kann dabei helfen, die Auswirkungen des Bruxismus auf das Kiefergelenk zu beurteilen.
Die zugrundeliegenden Erkrankungen für eine CMD sind vielfältig, prinzipiell lassen sich aber Erkrankungen der Kaumuskulatur (Myopathien), Erkrankungen der Kiefergelenke (Arthropathien) und Okklusionsstörungen (Okklusopathien) unterscheiden. Eine klinische Untersuchung kann häufig bereits Hinweise auf eine Ursache liefern, meist ist jedoch ein bildgebendes Verfahren wie die MRT Kiefer-Untersuchung zur sicheren Differenzialdiagnostik erforderlich.
Bislang waren hier die konventionellen Röntgenverfahren, die Arthrografie und die konventionelle Tomografie dominierend. Doch in den letzten Jahren hat sich die MRT im klinischen Alltag durch ihrenexzellenten Weichteilkontrast und die hohe örtliche Auflösung als Standarduntersuchungsverfahren etabliert. Insbesondere bei folgenden Krankheitsbildern kann eine MRT-Untersuchung zielführend für die Diagnostik sein:
- Dislokation des Discus articularis
- Gelenksergüsse
- Arthrose des Kiefergelenks
- Osteonekrose/Osteochondrosis dissecans
- Gelenkentzündungen (Arthritis), z.B. bei rheumatoider Arthritis, Psoriarsis-Arthritis, juveniler idiopathischer Arthritis, Gicht, Lupus erythematodes
- Tumoren (sehr selten)
- Metastasen, z.B. bei Mamma- oder Lungenkarzinomen, multiplem Myelom
In der akuten Diagnostik bei Traumata wie z.B. bei Schädelbasis- oder Unterkieferfrakturen spielt das MRT eine eher untergeordnete Rolle. Bei der Beurteilung posttraumatischer Veränderungen, wie beispielsweise Gelenkergüssen, kann dieses Verfahren allerdings wegweisend sein.
Der Kiefer im Fokus – Magnetresonanztomographie des Kiefers
Da die relevanten Strukturen des Kiefergelenks sehr klein sind, ist eine hohe örtliche Auflösung und ein gutes Signal-zu-Rausch-Verhältnis bei der bildgebenden Diagnostik wünschenswert. Genau hier kann die MRT Kiefer-Untersuchung punkten. Im Gegensatz zu CT und Röntgen werden bei der MRT die Bilder mittels starker Magnetfelder und Radiowellen aufgenommen.
So gelingt der Blick ins Körperinnere gänzlich ohne den Einsatz von Röntgenstrahlen. Das Gelenk wird zunächst schichtweise gescannt, sodass zahlreiche, präzise, zweidimensionale Schnittbilder in hoher Auflösung entstehen. Diese können anschließend am Computer übereinandergelegt werden, wodurch sich beim Betrachten ein dreidimensionales Bild ergibt.
Der große Vorteil des MRT Kiefers liegt im hohen Weichteilkontrast. Daher ist sie insbesondere bei der Beurteilung von Entzündungen des Knochens und der Weichteile sowie von Schäden des Kapsel-Band-Apparates und Gelenkbinnenverletzungen den übrigen bildgebenden Verfahren häufig deutlich überlegen. Kleinste, sonst nicht sichtbare Läsionen können oftmals per MRT Kiefer sichtbar gemacht werden.
Schritt für Schritt: Eine MRT des Kiefers erklärt
Die MRT-Untersuchung des Kiefergelenks wird in der Regel in Rückenlage durchgeführt. Der zu untersuchende Bereich wird zusätzlich mit einer speziellen Kopf-Hals-Spule fixiert. Anschließend werden Sie mit dem Kopf voraus in die Röhre des MRT-Scanners gefahren. Während der gesamten MRT Kiefer-Untersuchung befindet sich der zu untersuchende Abschnitt immer in der Mitte des Gerätes, wodurch Ihr Kopf während des gesamten Zeitraums in der Röhre verbleibt.
Wenn Sie unter Platzangst leiden oder Bedenken vor engen Räumen (sog. Klaustrophobie) haben, könnte ein offenes MRT-Gerät eine geeignete Alternative sein. Bei dieser Variante liegen Sie nicht in einer Röhre, sondern zwischen zwei Blöcken, was Ihnen einen freien Blick „nach draußen“ ermöglicht. Beachten Sie jedoch, dass die Untersuchung bei den offenen Geräten oft etwas länger dauern kann, die Verfügbarkeit begrenzt ist und die Bildqualität leicht beeinträchtigt sein kann.
Die MRT-Untersuchung des Kiefers ist schmerzfrei, und in der Regel wird dabei kein Kontrastmittel verabreicht. Während der Untersuchung können jedoch laute Klopfgeräusche aufgrund der starken Magnetfelder auftreten. Um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, erhalten Sie während der MRT Kiefer-Untersuchung Ohrstöpsel und Kopfhörer.
Wegen des starken Magnetfelds ist außerdem bei Metallteilen im Körper Vorsicht geboten. Insbesondere metallische Implantate, die nicht MRT-tauglich sind, können eine MRT-Untersuchung unmöglich machen. Dazu zählen:
- Herzschrittmacher und Defibrillatoren
- Cochlea-Implantate
- Neurostimulatoren
- implantierte Insulinpumpen
- Blasenschrittmacher
- kupferne Verhütungsspiralen
Auch größere Tätowierungen und Permanent-Make-up können zum Problem werden. Sofern metallhaltige Farbstoffe verwendet wurden, können sich die betroffenen Stellen bei der MRT-Untersuchung stark erwärmen. Über diese Ausschlussfaktoren für eine MRT wird ihr Arzt sie aber im Einzelfall beraten. Unmittelbar vor Beginn der Untersuchung müssen alle metallischen Gegenstände ablegen.
Dazu zählen auch Brillen, Uhren, Schmuck, Haarnadeln, Piercings, Kleidung mit Gürtelschnallen und BHs mit Bügeln. Metallteile im Körper wie zum Beispiel fester Zahnersatz, Gelenkprothesen oder Metallplatten nach Operation eines Knochenbruchs stellen in der Regel kein Problem dar.
Quellen
- Reiser, M., Debus, J., & Kuhn, F. (2011). Duale Reihe Radiologie (3. Aufl.). Georg Thieme Verlag KG.
- Aumüller, G., Aust, G., Engele, J., Kirsch, J., Maio, G., Mayerhofer, A., . . . Zilch, H. (2017). Anatomie (4., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Thieme.
- Langner, S. (2013). MRT des Kiefergelenks. Radiologie up2date, 13(2), pp. 109-124. doi:10.1055/s-0032-1326200
- https://flexikon.doccheck.com/de/Craniomandibul%C3%A4re_Dysfunktion (zuletzt zugegriffen am 11.07.2022)
- https://flexikon.doccheck.com/de/Kiefergelenk (zuletzt zugegriffen am 11.07.2022)
- https://www.netdoktor.de/krankheiten/cmd/ (zuletzt zugegriffen am 11.07.2022)















